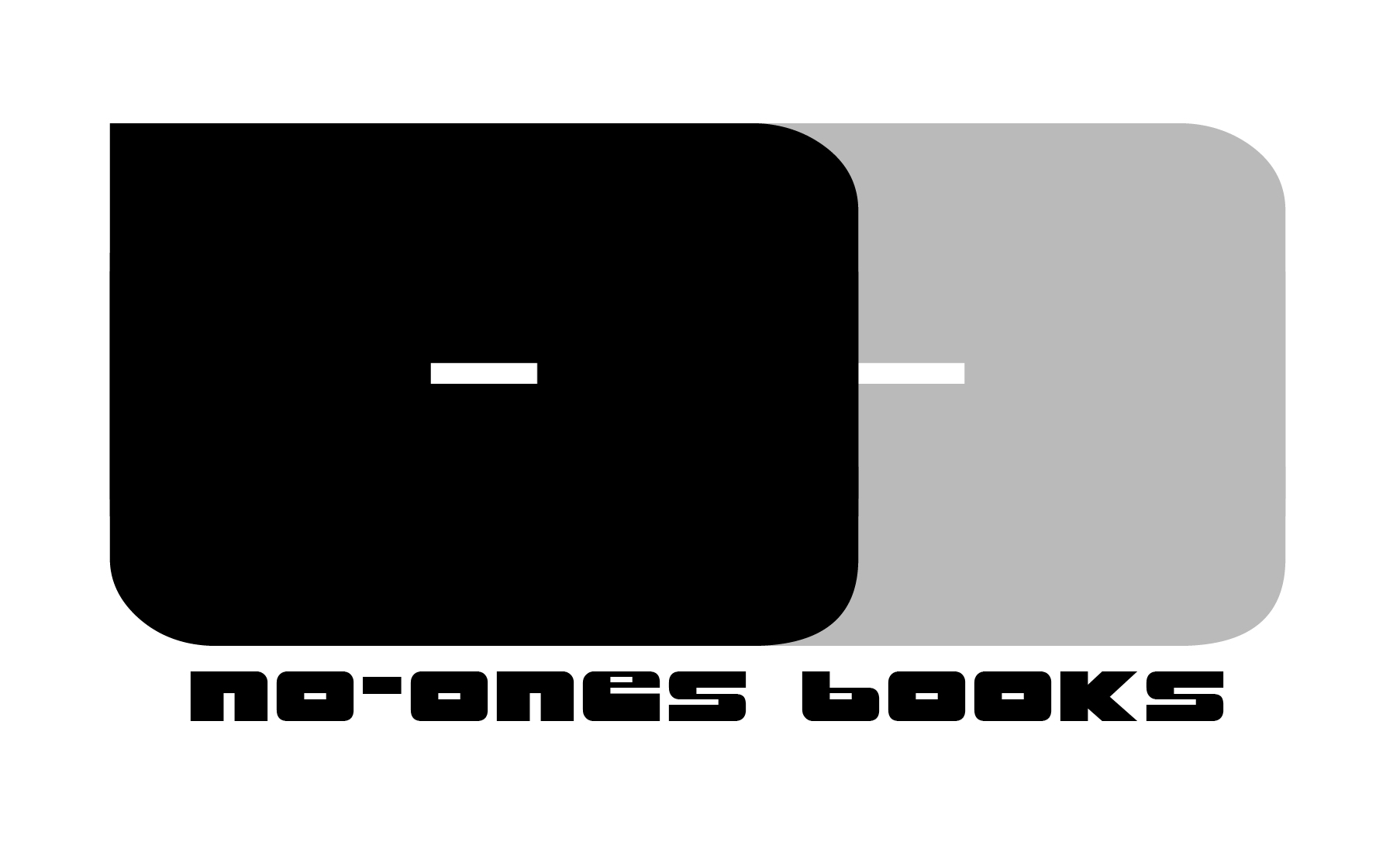Rewind: Klassiker, neu gehört
Rewind: Klassiker, neu gehört
The Cure – Disintegration (1989)
Das Filter – Gespräch: Thaddeus Herrmann, Martin Raabenstein vom 17.04.2019
Am 2. Mai 1989 erschien das achte Studioalbum von The Cure. „Disintegration“ gilt als eine der einflussreichsten Platten der Band um Robert Smith überhaupt. Zwei Jahre nach „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“, dem im grellem Orange leuchtenden Doppel-Album, kehrt die im freien Fall befindliche Gruppe zur konzeptuellen Düsternis zurück, die sich jedoch in einem ganz anderen Sound präsentiert. Martin Raabenstein und Thaddeus Herrmann heuern auf einem Öltanker an und schippern 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Zwischen den Stromschnellen der Geschichte des hochtoupierten Leidens wird schnell klar, dass die gemeinsame Seefahrt weder lange dauert, noch lustig ist. Ist das noch innovativ oder nur noch rezitativ? Simon Reynolds wirft den beiden Rezensenten den Rettungsring des Best-of zu, stimmt das „Lullaby“ an, kann aber auch nicht verhindern, dass es kommt, wie es kommen muss. I will always love you.
Martin Raabenstein: Vorsichtige Annäherung von mir diesmal.
Thaddeus Herrmann: Oha, ich rieche Trouble.
Martin: Irgendetwas in mir will mächtig auf die Kacke klopfen, macht es aber nicht.
Thaddeus: Dann erzähle ich dir erstmal, wie ich dieses Album kennengelernt habe. Das muss im Sommer 1990 gewesen sein, also ein Jahr, nachdem es erschienen war. Wir waren auf Kursfahrt in Krakow, es ging gen Auschwitz. Einen Tag machten wir einen Ausflug in ein stillgelegtes Bergwerk. Mit Kapelle und Tennisplatz unter der Erde. Davor war ein kleiner Kiosk und dort kaufte ich das Album auf Bootleg-Tape. Bekam man damals überall in der Gegend – für ungefähr 15 Pfennige pro Kassette. Die restlichen Tage hörte ich die Platte im Walkman. Fand ich toll.
Martin: Das ganze Album kannte ich noch gar nicht. Mein Interesse an den späten The Cure ging proportional zur Körperfülle von Herrn Smith stark zurück. 1989 war MTV-at-its-best und „Lullaby“ quasi stündlich auf dem Kanal, an „Lovesong“ kann ich mich auch noch erinnern. War gut, nett, lustige Videos. Punkt. Die anderen Tracks auf „Disintegration“ höre ich nun zum ersten Mal. Mein Rechner ist noch zu keinem Ergebnis gekommen, das Rad des Todes – du sagst Beachball – dreht sich immer noch.
Thaddeus: Haha, rundlich war Smith damals ja noch nicht. Und doch magst du die Platte und ihre guten Songs nicht. Skandal. Die Singles sind okay, aber doch irgendwie ausgeleiert und vergleichsweise labbrig. Der Rest der Platte ist viel besser. Und erstaunlich kompromisslos. Will sagen: Eigentlich ist es ja nur ein Song, den er immer wieder ganz sachte um- und verbiegt. Nun ist dieser eine Song schlichtweg toll, ergo das Album über weite Strecken auch. Was hören wir jetzt?
Martin: Was genau – ehm – findest du an „Plainsong“ toll?
Thaddeus: Lange nicht mehr so wunderbar einlullende Synth-Streicher gehört. So geht es los. Trotz des schleppenden Tempos – Thema der Platte, müssen wir noch drüber reden – entwickelt es sich zu einem beeindruckenden Stück Hymnen-Emulation. Klasse. Und dann nimmt er den gleichen Song einfach noch fünf Mal auf. Dreister Kerl. Ich nenne ihn in der Einzahl und nicht die Band als Ganzes, weil die hatte bei der Platte wenig zu sagen. Hätte er öfter so machen sollen. Aber einordnend betrachtet: Dieses Überbordende gab es ja auch auf dem Vorgänger „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ zu hören – das zerfaserte mir da aber noch zu sehr, wurde immer wieder gebrochen. Hier fließt das einfach dahin. Wem das zu tranig ist, klar, der ist raus. Ich bleib‘ derweil aber noch ein bisschen in dem Kahn sitzen.
Martin: Kahn, merkwürdig, die Assoziation hatte ich auch zunächst. Stell dir vor, du liegst an deinem Traumstrand und so ein kilometerlanger Öltanker schiebt sich langsam von rechts in dein Urlaubsidyll rein und parkt dann genau dort. Was tust du? Den Strand wechseln? Okay, du läufst ein paar Buchten weiter, breitest dein Tuch aus, bettest dein Haupt und – da ist er immer noch, dieser monolithische Rieseneimer. Böh.
Thaddeus: Wer liegt da am Beach, wer ist der Kapitän und wer parkt ein?
Martin: Ich höre das Album und bin betäubt. Das Ganze hat etwas, das eigentlich in den Siebzigern ausgestorben zu sein schien. Dinosaurier-Band sagte man dazu. Groß auftretend, aber völlig leer im Inhalt. In meinem Beispiel ist der Öltanker also noch höher, weil er mangels geladener Fracht so richtig hoch auf dem Wasser steht.
Thaddeus: Du hattest schon erwähnt, dass dieses Album für dich schon die späten Cure symbolisiert. Das stimmt ja aber eigentlich gar nicht. Natürlich ließe sich argumentieren, dass die „prägende Zeit“ vorbei war, aber das liegt immer im Auge der Betrachter*innen. Wer so lange dabei ist – 1989 ja schon mehr als zehn Jahre – bespielt ja auch immer mehrere Generationen. À propos: Hast du gerade dein Lieblings-Jahrzehnt in Grund und Boden gedisst? Das lobe ich mir. Auch sonst hast du nicht recht. Mit den Jahren ist bei der Band einfach die viel zu offensichtlich zur Schau gestellte Düsterheit langsam in die Atmosphäre verdampft – ja, der Nebel hat sich gelichtet. Darum stehen die Songs hier auch nackter da – nicht hinter weniger Hall, sonder hinter einem anderen. Klar wird der Tanker damit leichter, kann eleganter manövrieren und dir von Strand zu Strand folgen. Hast du Pech gehabt – der folgt dir bis in den Landwehrkanal hinein.
Martin: Ach Thaddi, du bist echt drollig. Auch andere Jahrzehnte hatten diesen Drang zur Gigantomanie, nur die Siebziger gaben dieser Verausgabung einen Namen, Punk sei Dank. Ein paar zugegebenermaßen wirklich tragische Niedergänge bilden noch lange kein Totalversagen ab. Mit The Human League haben wir neulich den Beginn einer musikalischen Epoche besprochen, das hier ist eindeutig weit hinter deren Ende. Und ich erkläre dir auch, warum ich nicht so richtig die Klappe aufreißen will. Was ich hier höre, macht mich traurig, wie eine ungegossene, verödete, ehemalige Grünfläche. Das klingt wie ein Best-Of-Cure-Album mit neuer Vertonung. Alle über die Jahre verwendeten Elemente dürfen ein kleines Solotänzchen aufführen – und aus die Maus. Danach war bei der Band erst mal Pause, das Nachfolgealbum „Wish“ wurde drei Jahre später releast. Habe ich auch nie gehört. Zurück zu meiner vorsichtigen Haltung. The Cure war nicht die einzige Band, die sich immer tiefer in ihrem eigenen Sog verwirbelte. Ich möchte The Cure aber einfach nicht scheiße finden, dazu liebe ich deren frühe Arbeiten zu sehr. Leg‘ „17 Seconds“ auf und ischziehmischnaggischaus!
Thaddeus: Dann hätte wir uns für die 9er-Jahre eben für „Three Imaginary Boys“ entscheiden sollen – von 1979 – und „17 Seconds“ dann nachschieben können. Nun ja. Ich kann so ungefähr nachvollziehen, was dein Problem mit der Platte ist – voll okay. Jeder Track spricht hier auch nicht zu mir, ich bin aber doch erstaunt darüber, wie gut sich andere gehalten haben. Ich mag den Habitus. Minimal ist das alles nicht, aber über weite Strecken doch sehr passend. Ich will Smith und seine Jungs jetzt auch nicht endlos verteidigen – dazu sind sie mir dann doch nicht wichtig genug. Ich bin mit den frühen Hits aufgewachsen, die liefen auf Partys rauf und runter. „Faith“, „Pornography“ – das waren Alben, die ja auch in die Zeit passten, ich aber auch nicht mehr in Echtzeit miterlebt habe. Im Nachhören passte es dann immer noch ganz gut in meine ganz eigene Zeit. In der blieb ich eine Weile hängen. „Kiss Me Kiss Me Kiss Me“ war dann das erste Album, das ich zur VÖ gekauft habe. Fand ich gut, aber auch ein bisschen weird. Verglichen damit passt das hier doch alles bestens zusammen.
Martin: Ich war nie an der Person hinter der Musik interessiert, das war früher schon eher irritierend und ist heute ein unglaublich nerviges Thema. Dieses ganze Jackson-darf-man-Jackson-darf-man-nicht geht mir sowas von auf die Nüsse – und die geschwollenen Hoden des Verliebt-verlobt-verheiratet-Smith an dieser Stelle ziemlich am Mittelfinger vorbei. Ich bin offensichtlich noch nicht alt genug, um wirklich einsehen zu müssen, dass etwas so unglaublich Gutes auch einmal zu seinem Ende kommen muss.
Thaddeus: Da musst du mir jetzt schon noch einiges erklären bitte. Ich interessiere mich auch einen Scheiß für Robert Smith. Trotzdem ordnen wir ja aber die Musik ein. Was jetzt Jackson damit zu tun – You. Tell. Me.
Martin: Smith, so habe ich gelesen, war zur Zeit der Produktion des Albums in Hochzeitsgefühlen, überschwänglich also, derart over-the-top, dass er alles an sich gerissen und dieses Produkt hier quasi im Alleingang hinlegte. Aber eigenartig, dieses Glücksmoment verspüre ich hier nicht, mit Ausnahme von „Lovesong“ vielleicht. Eher ein Ich-bringe-alles-noch-mal-auf-den-Punkt und dann lass uns heiraten. Ein Resümee: Tschüss, war schön hier, aber ich muss jetzt mal poppen gehen. Könnte auch etwas länger dauern.
Thaddeus: Deinen Best-of-Gedanken von eben verstehe ich. Aus Fan-Sicht wäre das ja im Idealfall das perfekte Album. Perfekt finde ich das hier nicht, nur über weite Strecken einfach sehr gut. Um weiter in deinem Kopf zu kramen: Dir ist das a) nicht innovativ genug, sondern vielmehr zu rezitativ und b) zu stromlinienförmig. Liege ich damit richtig?
Martin: Es ist natürlich herrlich, von Herrn Herrmann bekramt zu werden. Musikalisches Erleben ist meiner Meinung nach immer eine Spiegelung des Selbst, vor allem in jungen Jahren. 1989 war ich aber sowas von HipHop-trunken, da war The Cure einfach nicht mehr auf meinem Schirm. Wenn ich jetzt etwas höre, was mich damals nicht interessierte, ist das merkwürdig. Ich möchte The Cure in guter Erinnerung behalten, das Album hier stört mich dabei. Jetzt, nach dem dritten Hördurchgang drängt sich mir so eine mögliche Verbindung zu Shoegaze auf. Möglicherweise haben die Schuhspitzen-Herren zu sehr an der „Disintegration“ geschnüffelt und sich taumelnd in dieses Loch fallen lassen.
Thaddeus: Aus dieser These würde Simon Reynolds ein Buch machen, was unter Umständen sogar ganz unterhaltsam sein könnte. Ich weiß nicht recht, ob ich mich darauf einlassen möchte. Ein großer Einfluss für die Shoegazer*innen war das Album bestimmt, eins zu eins übersetzt wurde hier aber nichts. Das ist eher und mal wieder eine Frage des Gefühls: Der erhabene Duktus der ersten Tracks wirkte nach, wurde auf „Disintegration“ aber natürlich auch nicht erfunden. Und: Shoegaze ist ohnehin ein viel zu heterogener Begriff, kaum mehr als ein musikalischer Regenschirm, unter dem sich ganz unterschiedliche Entwürfe entwickelten. Für mich ist das Album ganz klassisches Cure-Material, trotz allem Wandel. Die betonte Kühle der frühen 1980er-Jahre ist einer gewissen Wärme gewichen, die die Musik natürlich auch für viele Menschen nachvollziehbarer macht – einladender. Der Cocoon öffnet sich – über den Sound. Ob man jedoch mag, was hintenrum passiert, müssen dann alle selbst entscheiden.
Martin: Das Album hat so eine endlose Wiederholung in sich, die Intros wollen gar nicht aufhören, alle starren beim achten Loop irgendwohin, in die Ecke, auf den Verstärker – warum nicht auf die Schuhe? Denselben Track sechsmal variieren, ich möchte nicht in der Haut beziehungsweise in den Augen der zur Begleitband degradierten Musiker gesteckt haben. Darum die Idee mit der Blickrichtung. Nach unten ist sicherlich eine mögliche Lösung.
Thaddeus: Simon? Ja, hi, hier ist Thaddi. Du musst dieses Buch doch nicht schreiben. Nee, hat sich erledigt – der Raabe hat hier gerade ganz wunderbar die These geschärft. Der macht das selbst. Was? Ja, natürlich bekommst du eine Kopie vorab, ist doch Ehrensache.